Indianermärchen
Zurück
|
Translate my Homepage |
 30.03.2005
30.03.2005
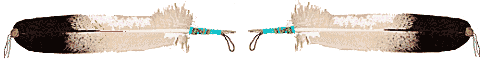
Inhalt:
Wie die Federhaube entstand
Weshalb der Rabe ein schwarzes Gefieder hat……
Warum die Eule sich nur noch nachts blicken läßt
Warum der Büffel einen Höcker hat (Chippewa)
Die Eule und der junge Krieger
Wie das Feuer auf die Erde kam (Cherokee)
Maismutter und schwarzer Meteor (Arikara)
Die Sage vom weissen Bison (Lakota-Sioux)
Der Flötenspieler und der Bär
Das Büffel-Rennen
Stoneboy
Warum der Kojote nachts heult..(Kojote und die Sterne)

Geschichtenerzähler....
Wie die Federhaube entstand
Vor einer langen, langen Zeit hatten die Cheyenne Krieger noch nicht erfahren, wie Adler für ihre Kriegsornamente zu benutzen ist. Einer ihrer Männer bestieg einen hohen Berg; dort saß er fünf Tage und weinte ohne Nahrung. Etwas Mächtiges, hoffte er, würde ihn sehen und zu ihm kommen, um ihn etwas Großes für seine Leute zu lehren.
Er war froh, als er eine Stimme sagen hörte: "Versuch, tapfer zu sein, ganz gleich, was kommt, selbst wenn es Dich töten könnte. Wenn Du Dich an diese Wörter erinnerst, wirst Du große Neuigkeiten für Deine Leute haben und ihnen helfen ." Nach einer Zeit hörte er Stimmen und sah wie sieben Adler die herunterkamen, als ob sie mit wegfliegen wollten.

Aber er war tapfer, wie es ihm gesagt worden war, er weinte und hielt seine Augen geschlossen. Jetzt umgaben ihn die großen Adler. Sie sagten: "Sieh uns an. Wir sind mächtig, und wir haben wunderbar starke Federn. Wir sind größer als alle anderen Tiere und Vögel in der Welt."
Ein mächtiger Adler zeigte dem Mann seine Flügel und seinen Schwanz, und er breitete all seine Federn so weit wie möglich aus. Er zeigte ihm, wie Kriegskopfschmuck und Ornamente aus Adlerfedern gemacht werden kann.
"Die Leute müssen nur die Adlerfedern benutzen und es würde ihnen eine große Hilfe sein, bei Krieg und ihnen Siege bringen", sagte Adler.
Da keine losen Federn da waren, schüttelten sich die sieben Adler, und eine Menge Federn fielen zu Boden. Der Cheyenne hob sie auf und nahm sie dankbar zu seinem Stamm mit nach Hause. An diesem Tag wurden Adlerfedern zum ersten Mal von den Cheyenne gesehen, und sie wussten, was sie tun mussten.
Der Mann zeigte seinen Leuten, wie man Kriegsornamente von den Adlerfedern machte, da ihm es gesagt worden war. Von diesem Tag an wurde der Mann ein großer Krieger in seinem Stamm, ihr Anführer bei Kriegszügen.
Er war sehr erfolgreich und sein Volk nannte ihn Chief Adlerfeder. Er trug seine Adlerfeder-Kriegshaube und führte die Cheyenne mit Würde und Stolz.

Weshalb der Rabe ein schwarzes Gefieder hat…… 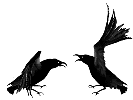
Nachdem der Gottschöpfer die Tiere gemacht hatte, formte er am Ende noch den Raben und die Eule. Aber er hatte kein Farbe mehr übrig, weil er die meisten Vögel in seiner Schöpferfreude sehr bunt angemalt hatte. Darum musste er den Raben und die Eule mit ungefärbten Federn davonfliegen lassen. Sie waren weiss wie frischer Schnee. »Es ist schlimm«, jammerte die Eule, »dass ich so hell aussehe. Wenn ich bei Nacht Beute fange, werden mich die Tiere schon von weitem erblicken und Reissaus nehmen. Wie soll ich mich da ernähren!« Und der Rabe fügte hinzu: »Ich möchte auch ein bisschen lustiger aussehen, als so langweilig weiss. Wie soll ich bei meinem Gefieder unter den Vögeln angenehme Gesellschaft finden? Komm mit, Frau Eule! Ich weiss einen Stoff, mit dem wir uns hübsche Muster aufs Federkleid malen können.« Das war der Eule recht. Sie flogen zum Wohnplatz des Raben. Dort stand eine erloschene Lampe, die mit Robbentran gefüllt war. Die Lappen hatten die Lampe zurückgelassen, als sie zum Meer aufbrachen, um Robben zu fangen. Im Gefäss hatte sich schwarzer, fettiger Russ niedergeschlagen. »Setz dich nieder und halte still, Frau Eule'« sagte der Rabe. Er riss sich eine Schwanzfeder aus und begann das weisse Kleid der Eule mit dem klebrigen Russ zu bepinseln. Reihe um Reihe tupfte er alle möglichen Figuren: Kringel, Striche, Häkchen und Wellen. Auf den Flügeln setzte er die Reihen dichter, auf Rücken und Brust lockerer. Als er fertig war, hüpfte er zurück und begutachtete mit kritischer Miene sein Werk. Es gefiel ihm ausnehmend. »Es sieht wirklich gut aus, Frau Eule. Ausgesprochen kleidsam. Sieh selbst! «
Die Eule besah sich im Wasserspiegel einer Pfütze, drehte und wendete sich, schaute und staunte, Plusterte sich auf und sagte: »In der Tat! Das hast du gut gemacht. Es gefällt mir. jetzt kommst du dran!« »Aber gib dir Mühe, bitte!« antwortete der Rabe, setzte sich zurecht, legte den Kopf schräg und schloss die Augen. jetzt nahm die Eule die Feder, dachte angestrengt nach und begann ihr Werk. Sie malte die lustigsten Figuren, die man sich denken kann. »Bist du bald fertig?« fragte der Rabe. »Halt still!« sagte die Eule und freute sich darüber, wie sie die herrlichsten Verzierungen anbrachte. »Bist du bald fertig?« wiederholte der Rabe ungeduldig. »Bald, bald!«
verwies ihn die Eule, brachte hier noch einen Strich an und fügte dort noch ein Ringelchen oder ein Kringelchen hinzu. »Bist du bald fertig?« drängte der Rabe. »Gleich, gleich! « antwortete die Eule. Nachdem sie die allerletzten
Tupfer ins Federkleid des Raben gesetzt hatte, fand sie, dass er viel schöner aussah als sie selbst. Da überkam sie der blanke Neid. »Bist du bald fertig?« stöhnte der Rabe. »Ich halte es kaum aus vor Neugier, dass ich mich sehen kann!« »Auf der Stelle!« antwortete die Eule, nahm die Lampe und kippte alles, was von dem schwarzen, russigen Tran übrig war, über den Raben. Denn sie konnte den Gedanken nicht ertragen, dass er so viel schöner aussehen sollte als sie selbst. Zornig krächzte der Rabe: »Oh, du böse Eule, du widerliches Nachtgespenst, du grässlicher Unglücksvogel, mich so zu verunstalten!« Er hüpfte in die Pfütze und wusch sich kräftig. Aber die Russfarbe klebte fest in seinem Gefieder. Da flog er auf, und während dicke Tränen aus seinen Augen auf die Erde tropften, krächzte er laut:
Ich heule, ich heule
wegen der neidischen Eule.
Ich weine, ich weine;
denn schuld ist nur eine,
dass ich so düster aussehe.
Wehe, wehe! Kräh, kräh ...
So kommt es, dass die Raben ein schwarzes Gefieder haben…..
Warum die Eule sich nur noch nachts blicken läßt
Vor langer Zeit riefen die Vögel einen Wettstreit aus. Der Vogel, der am höchsten in den Himmel aufsteigen konnte, sollte ihr König werden.
Der Adler  und die Eule
und die Eule  waren die Favoriten in diesem Wettstreit. Aber sie hatten die Rechnung ohne den Zaunkönig
waren die Favoriten in diesem Wettstreit. Aber sie hatten die Rechnung ohne den Zaunkönig 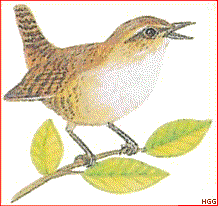 gemacht. Dieser listige kleine Kerl versteckte sich im Gefieder des Adlers und als dessen Kräfte schwanden, stieg er empor und gewann den Wettstreit.
gemacht. Dieser listige kleine Kerl versteckte sich im Gefieder des Adlers und als dessen Kräfte schwanden, stieg er empor und gewann den Wettstreit.
Der Zaunkönig wurde zum König der Vögel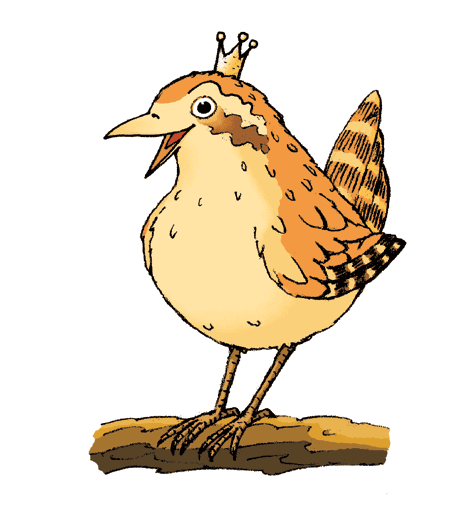 ausgerufen; doch nicht lange und der Schwindel wurde durchschaut. Die Vögel waren natürlich sehr wütend auf den kleinen Kerl und nahmen ihn gefangen.
ausgerufen; doch nicht lange und der Schwindel wurde durchschaut. Die Vögel waren natürlich sehr wütend auf den kleinen Kerl und nahmen ihn gefangen.
Die Eule wurde als Wächter bestimmt.
Jedoch sie war faul und müde und schlief ein. So konnte der Betrüger entkommen, und der Zorn der Vögel richtete sich von Stund an gegen die Eule.
Seitdem wird die Eule von ihnen gejagt und die Arme läßt sich nun nur noch nachts blicken.

Warum der Büffel einen Höcker hat (Chippewas)
Vor langer, langer Zeit, als die Welt noch blutjung war, hatte der Büffel keinen Höcker. Er bekam seinen Höcker eines Sommers, weil er sehr unfreundlich zu den Vögeln war.
Der Büffel liebte es, zum Spaß über die Prärie zu preschen. Die Füchse rannten ihm voraus und riefen den kleinen Tieren zu, ihr Häuptling, der Büffel, sei im Anmarsch.
Als eines Tages der Büffel wieder einmal über die Prärie jagte, stürmte er auf eine Stelle zu, wo kleine Vögel auf der Erde lebten. Sie riefen ihm und den Füchsen zu: "Pass auf! Unsere Nester!" Aber weder der Büffel noch die Füchse kümmerten sich darum. Der Büffel jagte weiter und zertrampelte die Vogelnester unter seinen schweren Füßen. Auch als er die Vögel schon laut schreien hörte, rannte er noch weiter ohne anzuhalten.

 zu bleiben.
zu bleiben.
Mit seinem Stock schlug er den Büffel auf die Schultern, sehr, sehr fest. Der Büffel krümmte aus Furcht, dass ein weiterer Schlag auf ihn niedersausen würde, die Schultern. Aber Nanabozho sagte nur: "Von diesem Tag an sollst du immer einen Höcker auf deinen Schultern haben. Und immer sollst du mit vor Scham gesenktem Kopf umherlaufen".
Die Füchse aber gedachten Nanabozho zu entkommen, rannten weg, gruben Löcher in die Erde und versteckten sich. Doch Nanabozho fand sie und erteilte ihnen die wohlverdiente Strafe. "Weil ihr so unfreundlich zu den Vögeln wart, sollt ihr immer in der kalten Erde leben müssen!" 
Seitdem wohnen die Füchse in den Löchern der Erde, und die Büffel haben Höcker auf den Schultern.

(Aus: "Indianische Legenden aus Nordamerika" von Ella Elizabeth Clark)
Die Eule und der junge Krieger (Märchen)
Verfasser nicht bekannt
Die Eule ist ein Kundschafter. Die Eule ist klug. Wenn eine Eule dich warnt, dann höre auf sie.
Hinhan Win, die Eulenfrau, sitzt in der Mitte der grossen Strasse, die wir Ta-canka und die Weissen "die Milchstrasse" nennen. Die Seele eines Toten muss über die Milchstrasse ziehen, wenn sie die glücklichen Jagdgründe
erreichen will. Selbst heute noch haben die meisten Indianer kleine Tätowierungszeichen auf ihren Händen und Handgelenken und seien es nur ein paar blaue Punkte. Wenn eine Seele oder wenn Geister vorbei wollen, schaut die Eulenfrau nach, ob diese Zeichen bei ihnen vorhanden sind. Wo nicht, stößt sie die Seelen von der Milchstrasse
herunter. Diese Tätowierungen sind die Pässe der Indianer zur Geisterwelt.
Nun, ein junger Krieger befand sich einmal auf einem Spähtrupp zum Dorf seiner Feinde. Er war schon den dritten Tag unterwegs. Er hatte ein kleines Zelt aufgeschlagen, etwa schulterhoch.

Darin hatte er
eine Schale Wasser, ein ganz kleines Feuer und seine Waffen. Er hatte ein Wildhuhn verzehrt, das er mit seinen Pfeilen erlegt hatte, und nun wartete er darauf, daß der Mond aufgehen werde. Dann wollte er weiter. Unterdessen fertigte er sich ein paar neue Pfeile, denn dies war Feindesland, und es mochte ja sein, daß er sie plötzlich brauchen würde.
Während er eine Pfeilschaft begradigte, hörte er plötzlich den Ruf von Hinhan Win, der Eule: " Wuh, Wuh, Wuh!"

Es kam so überraschend, daß er aufschreckte und die Pfeilspitze in die Schale Wasser vor sich fallen ließ. Er beugte sich vornüber, um sie wieder herauszuholen. Da sah er, widergespiegelt im Wasser, das Gesicht eines Feindes, der durch das Rauchloch oben auf ihn herabschaute. Er tat so, als habe er den Feind nicht bemerkt. Aber dann wandte er sich sehr rasch um, griff nach seinem Bogen und schoß
einen Pfeil gegen das Gesicht hin ab. So hatte der junge Krieger seinen ersten Feind getötet, "seinen ersten Schlag gelandet". Er hatte seine erste Adlerfeder verdient.
Und oh ja, auch auf seinem Spähtrupp war er erfolgreich. Er brachte seinen Leuten rechtzeitig alle Nachrichten, die sie brauchten. Die Eule hatte ihm das Leben gerettet. Wenn Hinhan Win ruft, tut man immer gut daran, dem Beachtung zu schenken.
Wie das Feuer auf die Erde kam (Cherokee)
Im Anfang war die Welt kalt, und die Tiere und Vögel hatten ihre Pelze und Federn sehr nötig, um sich warm zu
halten. Da schaute der Donnergott hinab auf die kalte, unfreundliche Erde, und er sah, daß es so nicht gut war.
Er schickte also einen Blitzstrahl hinab,

der setzte einen SykomorenBaum auf einer kleinen Insel in Brand.
Der Stamm loderte wie eine Fackel, und alle Tiere sahen zu und freuten sich über die helle Wärme. Aber wie
sollten sie das Feuer von der Insel zum Festland bringen? Sie hielten Rat, und ein jedes von ihnen wollte helfen.
Als erstes sprach der Rabe: "Das beste wird sein, ich fliege hinüber zur Insel und bringe etwas von dem Feuer
mit." Gesagt, getan. Er flog hin zu der Insel und versuchte, das Feuer zu holen, aber zurück kam er verbrannt
und verängstigt und ohne Feuer. Seit diesem Tag ist der Rabe schwarz. 
Als nächstes Tier versuchte es die kleine Eule. Sie kam wohlbehalten bis zu dem Baum, aber als sie in den
brennenden, hohlen Stamm hinabschaute, schlug ihr die Lohe ins Gesicht und verbrannte ihr beinahe die Augen.
Seither sind ihre Augen rot  und blinzeln bei grellem Licht.
und blinzeln bei grellem Licht.
Die schwarze Schlange wollte besonders schlau sein. Sie schwamm zu der Insel, kroch vorsichtig durch das
Gras und fand ein kleines Loch am Fuß des Stammes. Dort schlüpfte sie hinein und hoffte, sie werde ein wenig
Glut davontragen können. Aber im Innern des brennenden  Baumes war es schrecklich heiß.
Baumes war es schrecklich heiß.
Die Schlange
fürchtete zu ersticken. Rasch schnellte sie wieder zu dem kleinen Loch zurück und schlüpfte hinaus ins Freie.
Nachdem es auch der Schlange nicht gelungen war, das Feuer zu holen, waren die Tiere verzweifelt.
Keines wagte sich in die Nähe des glühenden Baumes, und immer noch war die Welt kalt und unfreundlich.
Da meldete sich die kleine schwarzrotgestreifte Wasserspinne und bat, einen Versuch wagen zu dürfen.
Sie webte eine kleine Schüssel und befestigte sie auf ihrem Rücken. Sie lief über das Wasser zur Insel, zog
ein winzig kleines Stück glühender Holzkohle aus dem Baum, glitt eilig wieder über das Wasser zurück zum
Festland und brachte den Tieren das Feuer.

Und wer sich heute die Wasserspinne anschaut, der wird auf ihrem Rücken immer noch die Schüssel entdecken,
in der sie die Wärme in eine kalte Welt trug.

Maismutter und Schwarzer Meteor (Arikara)
Die Alten sagen, daß die Erde zuerst von Riesen bewohnt gewesen sei, die so stark waren, daß sie vor nichts Angst hatten, nicht einmal vor Nesaru, der im Himmel wohnt. Zornig sah dieser ihrem Treiben zu und beschloß, sie zu vernichten. Daher sandte er die Spitzmaus
 auf die Erde, damit sie die Menschen, die ganz am Ende der Welt lebten und sich sehr vor den Riesen fürchteten, in Maiskörner verwandeln sollte. Die Spitzmaus verwandelte die Menschen in Maiskörner und versteckte sie tief unter der Erde. Auch die Tiere versteckte sie dort, damit sie sicher seien vor dem Vernichtungswerk.
auf die Erde, damit sie die Menschen, die ganz am Ende der Welt lebten und sich sehr vor den Riesen fürchteten, in Maiskörner verwandeln sollte. Die Spitzmaus verwandelte die Menschen in Maiskörner und versteckte sie tief unter der Erde. Auch die Tiere versteckte sie dort, damit sie sicher seien vor dem Vernichtungswerk. 
Dann sandte Nesaru, der im Himmel wohnt, die Maismutter auf die Erde, hieß sie die Menschen um sich sammeln, denn die kleinen Körner hätten sonst gar zu leicht verlorengehen können. Danach kehrte die Maismutter zurück zu Nesaru, der im Himmel wohnt, während die Spitzmaus bei den Menschen blieb.
Nun sandte Nesaru, der im Himmel wohnt, sein Strafgericht über die Riesen. Aber die Menschen waren tief unter der Erde zu dieser Zeit, daher weiß heute niemand, wie die Riesen umgekommen sind. Einige behaupten, daß es durch ein großes Feuer geschehen sei, während andere von einem großen Wasser wissen wollen. Nur Nesaru, der im Himmel wohnt, weiß es genau, aber er schweigt.
Während die Menschen als Maiskörner tief unter der Erde waren, hatte Nesaru, der im Himmel wohnt, dort oben Mais gepflanzt, damit er die Menschen in ihrem Versteck nicht vergesse. Als der Himmelsmais zu sprießen begann, sprach Nesaru, der im Himmel wohnt: “Jetzt ist es Zeit, daß die Menschen hervorkommen, denn der Mais will ans Licht.”
Als der Himmelsmais reif war, nahm Nesaru, der im Himmel wohnt, einen Kolben und sprach zu ihm: “Maismutter, gehe wieder hinunter und führe die Menschen hinaus, denn es ist Zeit.” Da verwandelte sich der Kolben in eine alte Frau, die sich sogleich auf den Weg zur Erde machte.
Lange irrte sie über die Welt, denn sie konnte keine Menschen finden. Auch die Stelle, wo die Menschen verborgen waren, hatte sie vergessen. Da hörte sie im Osten den Donner rollen. Sie folgte dem Laut und kam zu den Menschen unter der Erde. Als die Menschen und die Tiere in ihrem Versteck die Maismutter rufen hörten, beschlossen sie, an die Oberwelt zu kommen, denn Nesaru, der im Himmel wohnt, hatte seinen Boten geschickt.
Dachs,  Maulwurf und Wühlmaus
Maulwurf und Wühlmaus machten sich an die Arbeit, um ein Loch bis an die Oberwelt zu graben. Unter der Leitung von Spitzmaus arbeiteten sie an dem Tunnel, der sie hinausführen sollte aus der Dunkelheit. Dachs grub eine Weile, dann wurde er müde und sagte: “Oh, ich kann nicht mehr!” Nur Maulwurf grub emsig weiter und sah mit einem Male die Sonne scheinen. “Die Sonne scheint! Die Sonne scheint!” rief er aufgeregt. Da fand der Dachs seine Kräfte wieder und begann das Loch zu erweitern. Der Maulwurf jedoch, der zu lange in die Sonne gestarrt hatte, kann seit diesem Tage kaum mehr sehen. Daher blieb er zurück unter der Erde, wo es dunkel war und wo er sich auskannte.
machten sich an die Arbeit, um ein Loch bis an die Oberwelt zu graben. Unter der Leitung von Spitzmaus arbeiteten sie an dem Tunnel, der sie hinausführen sollte aus der Dunkelheit. Dachs grub eine Weile, dann wurde er müde und sagte: “Oh, ich kann nicht mehr!” Nur Maulwurf grub emsig weiter und sah mit einem Male die Sonne scheinen. “Die Sonne scheint! Die Sonne scheint!” rief er aufgeregt. Da fand der Dachs seine Kräfte wieder und begann das Loch zu erweitern. Der Maulwurf jedoch, der zu lange in die Sonne gestarrt hatte, kann seit diesem Tage kaum mehr sehen. Daher blieb er zurück unter der Erde, wo es dunkel war und wo er sich auskannte. Die übrigen Tiere aber begaben sich nach oben, dorthin, wo die Sonne ihr Licht verbreitete, und auch die Menschen machten sich auf den Weg an die Oberwelt.
Die übrigen Tiere aber begaben sich nach oben, dorthin, wo die Sonne ihr Licht verbreitete, und auch die Menschen machten sich auf den Weg an die Oberwelt.
Als alle aus der unteren Welt verschwunden waren, sprach die Maismutter zu denen, die sich auf der Erde versammelt hatten: “Ihr Menschen sollt mir folgen, wohin die Sonne wandert. Alles Getier aber soll dorthin ziehen, woher die Sonne gekommen ist. Wenn Menschen und Tiere sich fortan treffen, sollen sie sich nicht mehr erkennen, keine gemeinsame Sprache mehr haben, und Menschen sollen Menschen, Tiere aber Tiere bleiben, bis Nesaru, der im Himmel wohnt, alle zu sich ruft.” Und so geschah es denn auch, doch damals gab es eine Anzahl Wesen, die erst später zu Tieren geworden sind.
Lange folgten die Menschen der Maismutter über die Erde, und viele Hindernisse mußten überwunden werden. Bei jedem Hindernis aber blieben einige Menschen zurück und wurden zu Tieren. Dachs, Wühlmaus und Spitzmaus waren schon am ersten Tage umgekehrt, entschlossen, doch lieber bei Maulwurf zu bleiben. Am Fluße blieb Königsfischer  zurück mit seiner Familie, während die Eule
zurück mit seiner Familie, während die Eule  sich im Walde verirrte. Taucher konnte sich nicht vom See trennen, den sie alle überquert hatten, und Specht
sich im Walde verirrte. Taucher konnte sich nicht vom See trennen, den sie alle überquert hatten, und Specht
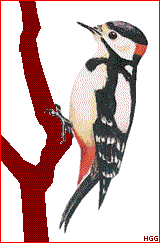
hatte einen hohlen Baum gefunden, der ihm besonders zusagte. Coyote aber hatte sich schon zu Beginn auf die Seite geschlichen  und selbständig gemacht. Schließlich kamen die Menschen im Gefolge der Maismutter an eine Stelle, von der die Maismutter sagte, daß hier das erste Dorf stehen sollte. Da machten sich die Menschen daran, Hütten zu bauen. Die Maismutter aber sprach: “Ich will euch von mir geben, damit ihr pflanzen könnt und zu essen habt. Denn fortan werdet auch ihr essen müssen, damit ihr zahlreich werdet wie die Maiskörner, die ihr einst gewesen seid.” Als sie all ihre Schätze verteilt hatte, ging sie zurück zu Nesaru, der im Himmel wohnt.
und selbständig gemacht. Schließlich kamen die Menschen im Gefolge der Maismutter an eine Stelle, von der die Maismutter sagte, daß hier das erste Dorf stehen sollte. Da machten sich die Menschen daran, Hütten zu bauen. Die Maismutter aber sprach: “Ich will euch von mir geben, damit ihr pflanzen könnt und zu essen habt. Denn fortan werdet auch ihr essen müssen, damit ihr zahlreich werdet wie die Maiskörner, die ihr einst gewesen seid.” Als sie all ihre Schätze verteilt hatte, ging sie zurück zu Nesaru, der im Himmel wohnt.
Während die Maismutter fort war, begannen die Menschen zu streiten, daher sandte Nesaru, der im Himmel wohnt, den Schwarzen Meteor auf die Erde. Dieser sollte Frieden stiften und den Menschen beibringen, wie sie zu leben hätten. Von ihm lernten die Menschen den Gebrauch von Werkzeugen aus Stein, die Wettspiele, die heiligen Gesänge und die Kriegsregeln, denn Schwarzer Meteor, der die heilige Pfeife  brachte, war der erste Häuptling der Menschen. Seit dieser Zeit hat es bei den Menschen Häuptlinge gegeben. Doch Nesaru, der im Himmel wohnt, war noch immer nicht mit den Menschen zufrieden. Noch einmal schickte er die Maismutter auf die Erde, damit sie den Menschen ihre Weisheit bringen sollte. Von ihr lernten die Menschen das Geheimnis der heiligen Medizinbündel, die großen Feste und Tänze, und von ihr haben auch die Medizinmänner ihre Kunst, Kranke zu heilen und Zauber zu bannen.
brachte, war der erste Häuptling der Menschen. Seit dieser Zeit hat es bei den Menschen Häuptlinge gegeben. Doch Nesaru, der im Himmel wohnt, war noch immer nicht mit den Menschen zufrieden. Noch einmal schickte er die Maismutter auf die Erde, damit sie den Menschen ihre Weisheit bringen sollte. Von ihr lernten die Menschen das Geheimnis der heiligen Medizinbündel, die großen Feste und Tänze, und von ihr haben auch die Medizinmänner ihre Kunst, Kranke zu heilen und Zauber zu bannen.
Die Maismutter jedoch trug den Menschen auf, sie in den Fluß zu werfen und zu ihr zu beten, wenn sie ihre Hilfe brauchten. Noch heute muß man daher an den Fluß gehen, wenn man die Maismutter um Hilfe bitten will. Für die Menschen ist sie Nährerin und Mutter zugleich, Sinnbild der Erde, aus der sie stammen. Ihr. heiliges Zeichen ist die ungebeugte Zeder, immergrünes Symbol der ewigen Mutter. Daher stellen die Menschen zu den heiligen Festen eine Zeder vor den Eingang zur Ratshütte,  damit die Mutter bei ihren Gebeten zugegen sei. Neben der Zeder aber liegt der Stein, Sinnbild des Schwarzen Meteors, der vom Himmel kam und die heilige Pfeife brachte. Wenn Zeder und Stein nicht mehr vor dem Ratszelt sein werden, dann ist die Zeit da, zu der die Maismutter wiederkehren wird, um ihre Kinder hinaufzuführen zu Nesaru, der im Himmel wohnt.
damit die Mutter bei ihren Gebeten zugegen sei. Neben der Zeder aber liegt der Stein, Sinnbild des Schwarzen Meteors, der vom Himmel kam und die heilige Pfeife brachte. Wenn Zeder und Stein nicht mehr vor dem Ratszelt sein werden, dann ist die Zeit da, zu der die Maismutter wiederkehren wird, um ihre Kinder hinaufzuführen zu Nesaru, der im Himmel wohnt.

Die Sage vom weißen Bison
Eines Sommers vor langer Zeit hielten die sieben heiligen council fires der Lakota-Sioux eine Zusammenkunft ab und schlugen ihr Lager auf. Die Sonne brannte vom Himmel und die Menschen sehnten sich nach etwas Unterhaltung. Zwei
junge Männer beschlossen, auf die Jagd zu gehen.
Auf ihrem Weg begegneten die zwei Männer einerwunderschönen jungen Frau, die ganz in Weiß gekleidet war; wenn sie ging, schien sie zu schweben.Einen
der Männer überkam ein unanständiges Verlangen und er versuchte, die Frau anzufassen.Doch als er dies tat,wurde er von einer riesigen Wolke eingehüllt und in einen Haufen Knochen verwandelt. Die Frau wandte sich an den zweiten Mann und sprach zu ihm: "Kehre zurück zu deinem Volk und sage ihnen, dass ich komme."
Diese heilige wakan-Frau brachte dem Volk der Lakota ein eingewickeltes Bündel. Sie wickelte es aus, gab den Menschen eine heilige Pfeife und lehrte sie, wie sie sie für Gebete benutzen sollten. "Mit dieser heiligen Pfeife werdet ihr wie ein lebendes Gebet gehen", sagte sie.
Die Frau erzählte den Lakota vom großen Wert des Bison, der Frauen und Kinder. "Ihr stammt von der Mutter Erde ab", sagte sie zu den Frauen. "Eure Taten sind genauso großartig wie die der Krieger."
Bevor sie ging, sagte sie den Menschen, dass sie zurückkehren würde. Als sie wegging, drehte sie sich viermal herum und verwandelte sich in ein weißes Bisonkalb; daher der Name Weiße Bisonfrau oder Weiße Bisonkalb-Frau.Es heißt, dass die Lakota nach diesem bedeutenden Tag ihre Pfeife ehrten und es Bisons im Überfluss gab (nach John Lame Deer's telling von 1967). Viele glauben, dass die Geburt des Bisonkalbes Miracle, das am 20. August 1994 in den Vereinigten Staaten zur Welt kam, die Vereinigung von Menschlichkeit zu einer Einheit von Herz, Gedanken und Geist symbolisiert.
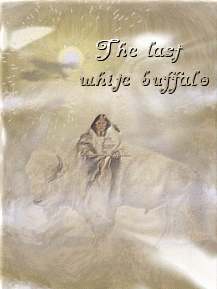
 Eine Prophezeihung wird wahr...Die Legende vom weißen Büffelkalb
Eine Prophezeihung wird wahr...Die Legende vom weißen Büffelkalb
Der Flötenspieler und der Bär
Vor langer Zeit, als das Grasland noch schwarz war von der großen Zahl der Büffel, die dort grasten, Als der Bär und der Wolf sich die Wälder teilten, als der Kuguar der König der Berge war und der Adler in den Wolken kreiste, beschloß ein Medizinmann mit vier jungen Kriegern in die Wälder zu gehen, um den Hirschen zu jagen.
Am Abend vorher wurden die Feuer angezündet und der Medizinmann tanzte und betete,dass der große Geist ihnen Jagdglück gab und er
betete zum Hirschen, dass sich ein Tier seines Volkes gab.

Die vier Krieger reinigten sich und beteten ebenfalls.
Am nächsten Morgen zogen die Fünf los.
Unter ihnen war ein junger Mann, ein Träumer und Flötenspieler, den viele im Dorf auslachten. Wenn sie ihn mit seiner Flöte sahen, lachten sie und fragten ihn:“ Wieviele Feinde hast Du schon damit erschlagen“?
Er antwortete nie und spielte seine Meldodien weiter.
Er hatte zwar von seinem Vater gelernt, wie man mit Pfeil, Bogen und Messer umzugehen hatte und sein Vater hatte ihm auch ein wunderschönes Pferd geschenkt, aber nichts war für ihn so wertvoll wie die Töne und Melodien, die täglich um ihn herum waren. Und es schien, als würden sie ihm zufliegen.
So spielte er auch auf dem Weg zu dem Wald, den der Medizinmann
ausgesucht hatte.
In diesem Wald lebte ein sehr alter Bär und man erzählte sich, saß in ihm die Seele eines großen Kriegers wohnte. Niemals hatte der Bär einen Menschen getötet, aber er wachte streng darüber, dass die Jäger nicht mehr nahmen, als sie brauchten. Er war der Hüter des Waldes und der Geist in ihm, war der Hüter der Gesetze.
Einige hatten bereits versucht den Bären zu überlisten, ihn zu umgehen oder ihn auszuschalten, aber außer einer kräftigen Tracht Prügel vom Bären, hatten sie nichts bekommen.
Auch der Medizinmann wusste davon, also ermahnte er die jungen Männer
mit reinen Herzen und Gedanken in den Wald zu gehen und nur ja nicht
den Bären zu reizen.
So gingen sie und fanden auch sehr bald eine Herde Hirschtiere. Sie hatten Glück, ein Tier opferte sich und gab sein Leben für die Anderen.
Der Medizinmann bedankte sich, rief die Männer zusammen und wollte
den Wald verlassen, aber drei von ihnen wollten noch nicht. Sie stritten mit dem Medizinmann, die Herde wäre so groß und man hätte auch noch nicht genug Vorräte für den herannahenden Winter.
Der Medizinmann winkte ab, denn er ahnte, was nun passieren würde. Der ganze Streit interessierte den Flötenspieler überhaupt nicht, er saß auf einem Stein und band die Töne, die er auf der Jagd gesammelt hatte zu einer wunderschönen Melodie.

Es dauerte nicht lange, da tauchte der alte Bär auf und stellte sich vor die Männer. Er brummte , stellte sich auf die Hinterbeine und zeigte ihnen seine großen Pranken. „Laßt uns gehen!“, sagte der Medizinmann, aber seine Männer gehorchten ihm nicht. Sie waren jung und das Jagdfieber hatte sie gepackt, also setzte der Medizinmann sich neben den Flötenspieler und ließ sie ihre Lektion lernen.
Der Erste rannte mit lautem Schrei auf den Bären los, sein Messer fest in der Faust. Der Bär ließ ihn kommen und sprang im letzten Moment zu Seite, dabei versetzte er dem Angreifer ein kräftigen Hieb mit der Pranke, sodaß der zwischen die Bäume flog und sich nicht mehr rührte.
Der Zweite hatte sich von hinten an den Bären herangeschlichen und spannte seinen Bogen, aber der Bär stand blitzschnell vor ihm und versetzte ihm einen kräftigen Stoß gegen die Brust. Der Krieger taumelte zurück, fiel hin und hatte Mühe Luft zu bekommen.
Der Dritte, er war sehr groß und kräftig, warf seine Waffen weg und besann sich auf seine Kraft. Er hatte schon viele Wettkämpfe im Ringen gewonnen und war weit bekannt.
Er ging auf den Bären zu, der sich wieder auf die Hinterbeine gestellt hatte und rang mit ihm. Sie rangen hin und her, und her und hin. Dem Bären schien es Spaß zu machen und dieser Krieger hielt sich weit länger auf den Beinen als seine Vorgänger.
All das beobachteten der Medizinmann und der Flötenspieler, von dem Platz, an dem sie saßen. Sie sprachen kein Wort und auch die Flöte war still.
Dann geschah es, dass der Bär in einen Dornenzweig trat und ein Dorn sich in seinen Fuß bohrte. Der Bär wurde wütend, sein Fuß schmerzte und er beendete kurzerhand den Kampf, indem er den Ringer einfach in die Büsche warf, wo der auch liegen blieb.
Brüllend vor Schmerz und Wut setzte sich der Bär hin und versuchte sich den Dorn aus der Pfote zu ziehen, aber er schaffte es nicht und wurde nur zorniger.
Der Flötenspieler hatte alles genau beobachtet und stand plötzlich auf, um auf den Bären zuzugehen.
„Was tust Du?“, fragte der Medizinmann, während er ihn am Arm festhielt.“Ich will ihm helfen!“ antwortete der junge Mann und deutete auf den Bären.
„Hast Du nichts gesehen? Und jetzt ist er auch noch wütend!“ sagte der Medizinmann. Aber der Flötenspieler ließ sich nicht abbringen und ging langsam auf den Bären zu. „Überlege genau, was Du tust!“ rief ihm der Medizinmann zu und setzte sich aufrecht hin, denn auch diese Lektion wollte er nicht verpassen.
In der Nähe des Bären lag ein Baumstamm, auf den ging der Flötenspieler langsam zu und setzte sich genauso langsam hin. Er wollte dem Bären Zeit geben, ihn zu prüfen. Und genau das tat der Bär, er beobachtete jeden Schritt, jede Bewegung und stellte fest, das dieser Mann kein Angreifer war. Also bemühte er sich weiter den Dorn herauszuziehen.
Der Flötenspieler saß auf dem Baumstamm und überlegte. Weder Schnelligkeit, noch List, weder Waffen noch Kraft hatten den Bären besiegt und wie er so da saß, fiel sein Blick auf die Flöte, die er immer noch in seiner Hand hielt.
Er begann zu spielen und schaute dabei auf den Bären. Er spielte die Melodie des Waldes, die Melodie der Flüsse, ein Lied nach dem anderen und währenddessen bemerkte er, dass der Bär ruhiger wurde.
Das war es, der Flötenspieler schickte ein Gebet zum großen Geist. Er betete für Töne, Melodien und Lieder und er spielte. Er spielte lange, sehr sehr lange, denn der große Geist hatte sein Gebet erhört.
Das Flötenspiel tat seine Wirkung,... zuerst beschwichtigte er die Seele des großen Krieger, des Wächters über die Regeln und dann wurde der Bär sanft. Er beruhigte sich und der junge Mann konnte Schritt für Schritt auf den Bären zugehen, bis er vor ihm kniete. Der Bär ließ ihn gewähren. Also legte der Flötenspieler seine Flöte beiseite, aber die Musik endete nicht, der Bär hatte sie in sein Herz aufgenommen.
Nun konnte der junge Krieger den Dorn aus der Pfote entfernen und dem Bären helfen. Dem Bären ging es bald wieder gut.

Der Flötenspieler kehrte zum Medizinmann zurück, sie holten schnell die Anderen und verließen den Wald mit dem erlegten Wild. Keiner sprach ein Wort und so kehrten sie schweigsam ins Dorf zurück, fast schweigsam, denn der Flötenspieler spielte auf dem Weg seine neuen Melodien, die er auf der Jagd gesammelt hatte.
Von nun an lachte niemand mehr im Dorf über den Flötenspieler, denn er hatte den Bären besiegt, indem er mit seinem Spiel das alte Bärenherz gewonnen hatte.
Und manchmal, wenn Du ganz still bist, kannst Du auch heute noch in dem Wald die Flöte hören und das liebevolle Brummen des Bären, aber nur wenn Du ganz ganz still bist.
Hierbei handelt es sich um eine Erzählung, die man in einigen Varianten vor allem bei den Cheyenne und bei den Sioux findet. Hier wird erklärt, warum Menschen Büffelfleisch essen, und warum die Elster ihre charakteristische schwarz-weiße Zeichnung hat.
Früher lebten alle Tiere friedlich miteinander, und keines fraß das andere. Alle Tiere hatten dieselbe Farbe, weil sich noch keines das Gesicht bemalt hatte. Die Büffel aber waren die größten und stärksten aller Tiere, und sie waren immer hungrig. Sie wollten der Herren aller Tiere werden, und deren Fleisch essen und dadurch noch stärker werden. Aber die Menschen behaupteten, daß sie die Herren über die Tiere sein sollten. Auch sie wollten die Stärke der anderen Tiere bekommen, indem sie deren Fleisch aßen.
Also forderten die Büffel die Menschen zu einem Rennen heraus. Der Sieger dieses Rennens sollte über alle Tiere herrschen. Die Menschen akzeptierten diese Herausforderung, aber da die Büffel vier Beine haben und sie nur zwei, verlangten sie, daß andere Tiere an ihrer statt ins Rennen gehen durften. Die Büffel waren damit einverstanden.
Die Menschen wählten nun unter den Tieren die Vögel, um sie bei dem Rennen zu vertreten. Und zwar wählten sie den Kolibri, die Lerche, den Falken und die Elster.
Auch alle anderen Tiere und Vögel wollten an dem Rennen teilnehmen, denn jedes von ihnen hoffte ebenfalls, das Rennen zu gewinnen, und die Herrschaft über die anderen Tiere zu erringen. Also nahmen alle Tiere Farbe und malten ihr Gesicht für das Rennen an - jedes nach seinen eigenen Vorstellungen:
Das Stinktier malte sich weiße Streifen als Zeichen für seine Art.

Der Hirsch bemalte sich ganz in der Farbe der Erde.

Der Waschbär malte sich schwarze Ringe um den Schweif und um seine Augen. 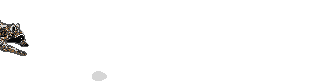
Die Drossel malte sich braun und mit einem roten Brustschild,

und die Elster schließlich trug schwarze und weiße Farbe auf.
Das Rennen sollte am Grunde der "Schwarzen Berge" stattfinden, an einem Ort, den man "das Büffel-Tor" nennt.

Am Start waren Holzstöcke ausgelegt, zwischen denen sich die Wettbewerber aufstellten. Das Rennen sollte bis zu einem Wendepunkt gehen, und von dort wieder zurück zum Startpunkt. Für die Menschen gingen also die Vögel an den Start, während für die Büffel ihre schnellste und ausdauerndste Kuh namens Schlankbüffel lief.
Mit einem Schrei wurde das Rennen gestartet und alle Tiere und Vöggel liefen los.
Der Kolibri 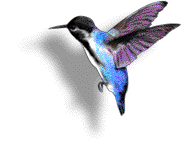
übernahm die Führung vor Schlankbüffel, aber seine Flügel waren so klein, daß er bald zurückfiel. Und als die Tiere sich dem Wendepunkt näherten, übernahm Schlankbüffel die Führung. Dann schloß die Lerche zu ihm auf, und die beiden gingen Seite an Seite in die Kehre. Doch Schlankbüffel rammte ihre Hufe in den Boden, daß es donnerte, und machte eine enge Kehrtwendung, während die Lerche eine weiten Bogen fliegen mußte.
eine weiten Bogen fliegen mußte.
Die führenden Tiere liefen nun an den Nachzüglern, die den Wendepunkt noch nicht erreicht hatten, vorbei. Die Lerche fiel zurück und feuerte den Falken 
an, der nun an ihr vorbeizog und sich anschickte, Schlankbüffel zu überholen. Tatsächlich sah es so aus, als könnte der Falke die Büffelin einholen, denn ihr Herz schlug schon schnell und ihre Beine wurden müde. Aber auch die Flügel des Falken wurden müde, und schon bald fiel er wieder zurück.
Schlankbüffel stürmte also auf das Ziel zu, und es sah ganz so aus, als sollten die Büffel die Herren über alle anderen Tiere werden und deren Fleisch essen dürfen.
Aber dann kam hinter der Büffelkuh, mit stetigem Flügelschlag, die Elster heran. Sie war nicht so schnell gestartet, wie die anderen, aber ihre Flügelschläge waren hart und gleichmäßig. Ihr Herz war stark. Ihre Augen ließen nicht von der Ziellinie ab. Sie hatte sich niemals umgeschaut. Ihre Flügel waren weit und sie trieb sich selbst Schlag für Schlag weiter vorwärts. Alle anderen Tiere waren nun zurückgefallen. Schlankbüffel blickte auf die Elster, aber diese schaute stets nur zu den Stöcken, die das Ziel markierten. Mit jedem Flügelschlag kam sie Schlankbüffel um nicht mehr als eine Schnabellänge näher.
Bei der Startlinie hatten sich nun viele Tiere versammelt, um den Ausgang des Rennens zu beobachten. Der Waschbär, der im Rennen früh ausgeschieden und zurück zum Start gekommen war, stellte sich nun dort zwischen die Stecken und hielt seine kleinen Hände in die Höhe, so daß die Läufer diese berühren konnten, wenn sie durchs Ziel liefen. Der Läufer, der seine Hand als erster berührte, zu dem würde er sich dann wenden und damit den Gewinner anzeigen.
Schlankbüffel kam nun mit großer Geschwindigkeit näher, und viele Tiere fürchteten, Waschbär würde totgetrampelt werden. Die Elster flog nun nach und nach immer näher am Boden, so daß sie die Hand des Waschbären im Vorbeiflug berühren konnte. Der Waschbär bewegte sich nicht, sondern starrte fest auf das heranrasende Paar. Die Elster schien nun die Büffelin zu überholen, aber diese beugte sich nach vorne, um die Hand des Waschbären mit ihrer langen Schnauze zu berühren. Aber einen Augenblick zuvor streifte die Elster mit ihrer Flügelspitze die Hand des Waschbären und dieser drehte sich zu ihr, während die Büffelin vorbeidonnerte und alles in einer riesigen Staubwolke verschwand. Alle Tiere warteten nun gespannt, bis der Staub sich wieder gelegt hatte. Aber am Ende konnten alle sehen, daß der Waschbär dort stand und mit seiner Hand auf die Bahn zeigte, auf der die Elster geflogen war.

So hatten die Menschen mit Hilfe der Vögel das Rennen gewonnen. Die Büffel wanderten von nun an in den großen Ebenen umher und fraßen Gras, während die Menschen große Jäger wurden und über alle Tiere herrschten.
Stoneboy
Die Geschichte von Inyan, dem Steinjungen
VOR LANGER ZEIT, in den großen Tagen der Indianer, lebte ein Mädchen zusammen mit ihren fünf Brüdern. Die Hauptbeschäftigung der Menschen zu dieser Zeit war die Nahrungssuche. Während die Schwester kochte und Kleidung fertigte, verbrachten ihre Brüder die Tage mit der Jagd.
Eines Tages zog diese Familie mit ihrem Tipi auf den Grund einer Schlucht. Es war ein eigenartiger und stiller Platz, aber es gab Wasser aus einem Fluss und viel Jagdwild. Im Sommer war die Schlucht kühl und im Winter schützte sie vor den Winden.

Wenn die Brüder unterwegs auf Jagd waren, wartete das Mädchen auf sie. Während sie wartete und lauschte, hörte sie Geräusche. Oft dachte sie es seien Schritte, doch wenn sie hinaus schaute, war niemand da.
Eines Abends geschah es, dass nur vier der fünf Brüder von der Jagd heimkehrten. Sie blieben die ganze Nacht über wach und fragten sich, was ihrem Bruder geschehen sein mochte.
Am nächsten Tag kehrten nur zwei Männer von der Jagd zurück. Wieder blieben sie auf und sorgten sich. In diesen frühen Tagen hatten die Indianer keine Zeremonien oder Gebete, die sie führen konnten, sodass es für die Schwester und ihre drei Brüder schwer war, an diesem unheimlichen Ort die Nacht durchzuwachen.
Die Brüder zogen am Morgen wieder los und nur ein einziger kam am Abend wieder zurück. Das Mädchen fing an zu Weinen und bat ihren Bruder, daheim zu bleiben. Aber sie mussten sich ernähren und so kam es, dass am Morgen der letzte der Brüder, der jüngste und ihr Lieblingsbruder, zur Jagd aufbrach.
Wie die Anderen kam er nicht zurück. Jetzt war niemand mehr da, der das Mädchen mit Essen und Trinken versorgte und schützte.
Das Mädchen verließ weinend die Schlucht und erklomm eine Hügelkuppe. Sie wollte sterben, wusste aber nicht wie sie das anstellen sollte. Da sah sie einen runden Kiesel auf dem Boden. Sie nahm ihn auf und schluckte ihn in der Annahme, dass dies sie töten würde. Mit Frieden im Herzen wandte sie sich zurück zum Tipi.
Als sie etwas Wasser trank, spürte sie, dass sich etwas in ihr rührte, als wenn der Stein ihr Mut zuspräche. Obwohl sie wegen ihrer verschwundenen Brüder keinen Schlaf fand, fühlte sie sich wohl.
Am nächsten Tag hatte sie nur noch etwas Pemmican und ein paar Beeren zum Essen übrig. Sie hatte vor, dies zu sich zu nehmen und etwas Wasser vom Fluss zu Trinken, merkte aber, dass sie nicht hungrig war. Es war, als sei sie auf einem Festmahl gewesen und sie schritt vor sich hin singend umher.
Den Tag darauf war sie so glücklich wie niemals zuvor. Am vierten Tag ihres Alleinseins bekam sie Schmerzen. Sie dachte: »Nun ist das Ende nah, jetzt werde ich sterben.«
Es machte ihr nichts aus. Aber anstatt zu Sterben, gebar sie einen kleinen Jungen. Sie fragte sich: »Was mache ich mit diesem Kind? Wie ist das passiert? Es muss der Stein sein, den ich schluckte.«
Es war ein kräftiges Kind mit glänzenden Augen. Obwohl sie sich eine Weile schwach fühlte, musste sie sich nun um das neue Leben, ihren Sohn, kümmern. Sie gab ihm den Namen Inyan Hokschi (Stein-Junge), und wickelte ihn in die Kleider ihrer Brüder.
Das Kind wuchs von Tag zu Tag, zehnmal schneller als gewöhnliche Kinder und hatte einen vollendeten Körper. Die Mutter wusste, dass ihrem Baby große Kräfte innewohnten.
Eines Tages, als er draußen vor dem Tipi spielte, fertigte er ganz allein einen Bogen und Pfeile. Die Mutter wunderte sich, wie er das geschafft hatte als sie die Steinspitzen der Pfeile betrachtete.
»Vielleicht erinnert er sich, dass er ein Stein war den ich schluckte« dachte sie, »er muss ein Steinwesen sein.«
Das Baby wuchs so schnell heran, dass es bald laufen konnte. Es bekam langes Haar und als der Junge heranreifte, bekam seine Mutter Angst, sie werde ihn verlieren, so wie sie ihre Brüder verloren hatte. Oft weinte sie, und obwohl er nicht fragte, schien es, als wüsste er warum.
Als sie sah, dass er sehr bald groß genug war, um auf die Jagd zu gehen, weinte sie mehr als je zuvor. Stein-Junge kam ins Tipi und sagte: »Mutter weine nicht!«
Sie sagte: »Du hattest fünf Onkel, aber sie zogen los, um zu jagen. Einer nach dem Anderen kamen sie nicht zurück.« Und sie erzählte ihm von seiner Geburt; wie sie den Hügel erklommen und einen Stein geschluckt hatte und wie sich etwas in ihr bewegte.
Er sagte: »Ich weiß. Und ich werde losziehen um deine Brüder, meine Onkel zu suchen«. – »Aber wenn du nicht zurückkehrst« schluchzte sie, »was werde ich dann tun?«
Er sagte: »Ich werde zurückkommen. Ich werde mit meinen Onkeln zurückkommen. Bleibe im Tipi bis es soweit ist.«
So kam es, dass Inyan Hokshi am nächsten Morgen loszog und aufmerksam Ausschau hielt. Bei Einbruch der Dunkelheit fand er einen guten Schlafplatz. Er wanderte vier Tage und am Abend dieses vierten Tages roch er Rauch. Inyan Hokshi, dieser Stein-Junge folgte dem Geruch. Er führte ihn zu einem Tipi, aus dessen Abzug der Rauch kam. Es war ein hässliches und baufälliges Tipi.
Im Innern konnte Inyan Hokshi eine alte Frau sehen die genauso hässlich war. Sie beobachtete, wie er vorbeiging, rief ihn an und lud ihn zum Essen und Übernachten ein. Obwohl er sich in seiner Haut nicht ganz wohl fühlte, ging Stein-Junge etwas ängstlich in das Tipi. Und er war gespannt.
Als er sich umsah, erblickte er fünf große Bündel die längs aufgestellt nebeneinander an der Tipi-Haut lehnten. Und er wunderte sich.
Die alte Frau war dabei, etwas Fleisch zu kochen. Als es fertig war, aß er es, obwohl es nicht gut schmeckte. Als sie ihm später ein altes dreckiges Büffelfell zum Schlafen bereitete, spürte er Gefahr und war sehr wachsam.
Die Frau sprach: »Ich habe Rückenschmerzen. Bevor du dich hinlegst, möchte ich, dass du mir den Rücken reibst, indem du auf ihm auf und ab gehst. Ich bin alt und ganz allein und habe niemanden, der mir meinen Schmerz nimmt.«
Sie legte sich hin und Stein-Junge begann auf ihrem Rücken zu gehen. Dabei spürte er etwas unter ihrem Ledermantel stecken - etwas Spitzes, wie ein Messer oder eine Nadel oder Speerspitze. »Womöglich hat sie dies benutzt, um meine Onkel zu töten. Vielleicht gab sie etwas Schlangengift auf die Spitze. Ja so muss es sein.«
Als ihm dies durch den Kopf ging, sprang Inyan Hokshi so hoch in die Luft, wie er nur konnte und landete krachend auf dem Rücken der Frau. Er sprang und sprang bis zur Erschöpfung, bis die Hexe mit gebrochenem Rückgrat tot dalag. Dann ging er hinüber zu den großen Bündeln, die in Tierhäute eingeschlagen und mit Lederriemen verzurrt waren.
Als er sie auswickelte, fand er fünf Männer tot und ausgetrocknet wie Trockenfleisch, kaum dass sie menschlich aussahen. Er dachte: »Dies müssen meine Onkel sein«, wusste aber nicht, wie er sie wieder zum Leben erwecken konnte.
Außerhalb des hässlichen Tipis war ein Haufen von runden, grauen Steinen. Er bemerkte, dass sie zu ihm sprachen und dass er sie verstand.
»Inyan Hokshi, Stein-Junge, du bist einer von uns, du kommst aus uns, du kommst von Tunka, du kommst von Inyan. Hör zu und gib acht.«
Ihren Anweisungen folgend baute er eine kleine kuppelförmige Hütte aus gebogenen Weidenästen. Diese bedeckte er mit den Büffelhäuten der alten Frau und brachte die fünf getrockneten Toten hinein.

Draußen im Freien baute er ein großes Feuer auf. Er legte die Steine direkt in die Flammen, nahm die alte Frau und warf sie ins Feuer, wo sie verbrannte.
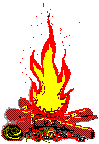
Als die Steine rot glühend waren, fand Stein-Junge ein Hirschgeweih, mit dessen Hilfe er die heißen Steine, einen nach dem anderen, in die kleine Hütte trug, die er gebaut hatte. Er füllte den Wasserschlauch der alten Frau, einer perlenverzierten Büffelblase, mit Wasser. Diesen zog er fest zu und nahm ihn mit hinein. Die mumifizierten Toten setzte er im Kreis um sich herum.
Inyan Hokshi schloss den Eingang seiner kleinen Hütte mit einer Büffelhaut, so dass weder Luft herein noch heraus konnte. Wasser über die Steine gießend dankte er den Steinen: »Ihr brachtet mich hierher.«
Viermal goss er Wasser auf, viermal öffnete er die Tür und schloss sie wieder. Die ganze Zeit sprach er zu den Steinen und sie zu ihm. Während er aufgoss, füllte sich die Hütte mit Dampf, so dass er außer dem weißen Nebel in der Dunkelheit nichts sehen konnte.
Als er das zweite Mal Wasser aufgoss, bemerkte er eine Bewegung.
Als er das dritte Mal aufgoss, begann er zu singen.
Und als er das Vierte Mal aufgoss begannen die Toten zu singen und zu reden.
Iran Hokshi, der Stein-Junge dachte: »Ich glaube sie sind wieder lebendig. Jetzt möchte ich meine Onkel sehen.«
Er öffnete die Tür das letzte Mal und sah den Dampf, der aus der Hütte quoll, als eine federleichte Wolke in den Himmel steigen. Beim Licht des Feuers und des Mondes, welches beides in die kleine Schwitzhütte schien, sah er fünf gutaussehende junge Männer darin sitzen.
Er sagte: »Hou, lekshi, ihr müsst meine Onkel sein.«
Sie lächelten und lachten, glücklich wieder am Leben zu sein.
Inyan Hokshi sagte: »Dies ist, was meine Mutter, eure Schwester, wollte. Das ist was sie sich wünschte.« Er sagte ihnen außerdem: »Der Stein rettete mich und nun hat er euch gerettet.
Inyan, Tunka-Stein, Tunka, Inyan.
Tunkashila, der Großvater Geist, wir werden lernen ihn zu ehren.
Diese kleine Hütte, diese Steine, das Wasser, das Feuer, sie sind heilig.
Wir werden sie gebrauchen so wie wir es heute zum erstenmal getan haben: Um uns zu reinigen, zu leben, für wichosani, für Gesundheit.
All das wurde uns gegeben so dass wir leben mögen.
Wir werden ein Stamm sein.«
Diese Version wurde laut Henrie Crow Dog um 1910 auf der Cheyenne-River-Reservation erzählt und von ihm 1968 in Rosebud Richard Erdoes weitergegeben. Aus: „American Myths and Legends“, Pantheon fairy tale & folklore Library;
S. Hartmann
Die Bezeichnung »Inipi« für die Schwitzhütte kann auf Inyan (Stoneboy)
als »Inyans Tipi« zurückgeführt werden.
Warum der Kojote nachts heult..(Kojote und die Sterne)
Vor sehr langer Zeit, bevor die Zweibeiner spazieren gingen, war die Erde, die Welt ganz anders, als sie jetzt ist. Am Anbeginn der Zeit gab es keine Sterne im Nachthimmel, und es gab keinen Mond. Die Nächte waren sehr dunkel, und die Tiere konnten nichts sehen.Wenn sie spazieren gingen, stießen sie aneinander. Schließlich redeten sie miteinander und entschieden sich den „Großen Geist“ um Hilfe zu bitten. Die Tiere versammelten sich und sprachen mit „Großem Geist“. Sie sagten „Großem Geist“, dass sie dankbar sind, für alles was sie hatten, doch jetzt wollten sie etwas anderes. Sie möchten imstande sein, nachts zu sehen. „Großer Geist“ nickte und lächelte und sagte, „meine Kinder beobachtet mich ". Er nahm dann einen hellen glänzenden Stein von einem Wasserlauf auf und setzte ihn in den Himmel, wo er ein Stern wurde. " Das ist euer Wegweiser“ erklärte "Großer Geist" er bewegt sich nicht, benutzt ihn, um Euren Weg nach Hause zu finden. Wenn Ihr Euren Weg nicht mehr findet, ist dieser
Stern „Polaris“ oder „Nordstern" Euer Wegweiser.  Dann sagte „Großer Geist“ den Tieren, sie sollten so viele dieser glänzenden Steine sammeln und in den Himmel bringen und dann ein Bild von sich machen. Die Tiere begannen diese Aufgabe, aber bald wurden die kleinen Tiere müde. Eine Weile später wurden die größeren Tiere auch müde. Zurück gingen sie zu „Großer Geist“ und baten um mehr Hilfe. "Geht zu Kojote" sagte „Großer Geist“ und bittet ihn, Euch zu helfen. „ Und das taten sie. Kojote dachte, dass er von allen Tieren am klügsten war, und er wollte nicht seine Zeit vergeuden, um den anderen Tieren zu helfen. Doch er wollte auch nicht „Großen Geist“ verletzen. So dass Kojote den Tieren sagte, ihre Steine bei ihm zu lassen und dass er den Job für sie beenden würde. Nachdem die Tiere gegangen waren , begann Kojote zu überlegen wie er ein Bild von sich selbst erschaffen könnte, das besser sein würde als alle die anderen .Er wollte die meisten Steine haben um von allen am hellsten zu sein! Plötzlich wurde Kojote daran erinnert, dass er die Arbeit der Tiere beenden muß. Kojote wollte nicht viel Zeit vergeuden, für die Bilder der anderen Tiere. Also raffte er eilends den Beutel von Steinen auf und schleuderte ihn in die Luft.
Dann sagte „Großer Geist“ den Tieren, sie sollten so viele dieser glänzenden Steine sammeln und in den Himmel bringen und dann ein Bild von sich machen. Die Tiere begannen diese Aufgabe, aber bald wurden die kleinen Tiere müde. Eine Weile später wurden die größeren Tiere auch müde. Zurück gingen sie zu „Großer Geist“ und baten um mehr Hilfe. "Geht zu Kojote" sagte „Großer Geist“ und bittet ihn, Euch zu helfen. „ Und das taten sie. Kojote dachte, dass er von allen Tieren am klügsten war, und er wollte nicht seine Zeit vergeuden, um den anderen Tieren zu helfen. Doch er wollte auch nicht „Großen Geist“ verletzen. So dass Kojote den Tieren sagte, ihre Steine bei ihm zu lassen und dass er den Job für sie beenden würde. Nachdem die Tiere gegangen waren , begann Kojote zu überlegen wie er ein Bild von sich selbst erschaffen könnte, das besser sein würde als alle die anderen .Er wollte die meisten Steine haben um von allen am hellsten zu sein! Plötzlich wurde Kojote daran erinnert, dass er die Arbeit der Tiere beenden muß. Kojote wollte nicht viel Zeit vergeuden, für die Bilder der anderen Tiere. Also raffte er eilends den Beutel von Steinen auf und schleuderte ihn in die Luft.

Die Steine waren hier und dort überall. Keiner der Steine hat wirklich geholfen ein Bild der Tiere zu schaffen. Und deshalb schien es, als ob nicht alle Konstellationen beendet seien. Einige Bilder konnte man erkennen und danach wurden sie benannt.

Aber Kojote wurde für seinen Verrat bestraft, weil er in seiner Eile vergaß, Steine für sein eigenes Bild zu aufzuheben. Kojote war wütend und er heulte in Wut.
 Dann sagte „Großer Geist“ den Tieren, sie sollten so viele dieser glänzenden Steine sammeln und in den Himmel bringen und dann ein Bild von sich machen. Die Tiere begannen diese Aufgabe, aber bald wurden die kleinen Tiere müde. Eine Weile später wurden die größeren Tiere auch müde. Zurück gingen sie zu „Großer Geist“ und baten um mehr Hilfe. "Geht zu Kojote" sagte „Großer Geist“ und bittet ihn, Euch zu helfen. „ Und das taten sie. Kojote dachte, dass er von allen Tieren am klügsten war, und er wollte nicht seine Zeit vergeuden, um den anderen Tieren zu helfen. Doch er wollte auch nicht „Großen Geist“ verletzen. So dass Kojote den Tieren sagte, ihre Steine bei ihm zu lassen und dass er den Job für sie beenden würde. Nachdem die Tiere gegangen waren , begann Kojote zu überlegen wie er ein Bild von sich selbst erschaffen könnte, das besser sein würde als alle die anderen .Er wollte die meisten Steine haben um von allen am hellsten zu sein! Plötzlich wurde Kojote daran erinnert, dass er die Arbeit der Tiere beenden muß. Kojote wollte nicht viel Zeit vergeuden, für die Bilder der anderen Tiere. Also raffte er eilends den Beutel von Steinen auf und schleuderte ihn in die Luft.
Dann sagte „Großer Geist“ den Tieren, sie sollten so viele dieser glänzenden Steine sammeln und in den Himmel bringen und dann ein Bild von sich machen. Die Tiere begannen diese Aufgabe, aber bald wurden die kleinen Tiere müde. Eine Weile später wurden die größeren Tiere auch müde. Zurück gingen sie zu „Großer Geist“ und baten um mehr Hilfe. "Geht zu Kojote" sagte „Großer Geist“ und bittet ihn, Euch zu helfen. „ Und das taten sie. Kojote dachte, dass er von allen Tieren am klügsten war, und er wollte nicht seine Zeit vergeuden, um den anderen Tieren zu helfen. Doch er wollte auch nicht „Großen Geist“ verletzen. So dass Kojote den Tieren sagte, ihre Steine bei ihm zu lassen und dass er den Job für sie beenden würde. Nachdem die Tiere gegangen waren , begann Kojote zu überlegen wie er ein Bild von sich selbst erschaffen könnte, das besser sein würde als alle die anderen .Er wollte die meisten Steine haben um von allen am hellsten zu sein! Plötzlich wurde Kojote daran erinnert, dass er die Arbeit der Tiere beenden muß. Kojote wollte nicht viel Zeit vergeuden, für die Bilder der anderen Tiere. Also raffte er eilends den Beutel von Steinen auf und schleuderte ihn in die Luft.

Deshalb heult Kojote nachts weil er ein Bild
von sich selbst im Nachthimmel nicht sehen kann!
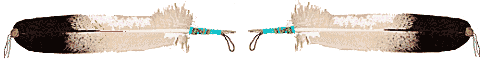
Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der
Autor dieser Homepage, kontaktierbar über dieses Formular!

